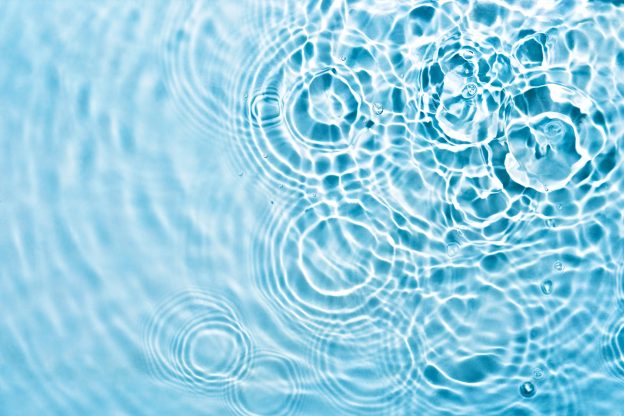Jeder Change Verantwortliche hat es schon erlebt: Mitarbeitende entscheiden selten rational im Vertrauen auf die Argumente des Managements, sondern lassen sich stark von Emotionen leiten. Kognitive Verzerrungen und soziale Einflüsse bestimmen unser Handeln oft stärker als logische Überlegungen. Das erkannte bereits Adam Smith im 18. Jahrhundert. Doch der Durchbruch der Verhaltensökonomie kam erst in den 1970er Jahren mit Daniel Kahneman und Amos Tversky, die mit der Prospect Theory zeigten: Verluste schmerzen uns mehr als gleich große Gewinne erfreuen (Verlustaversion). Für diese Forschung erhielt Kahneman später den Nobelpreis.
Verlustaversion und der Umgang mit Veränderungen
Im Change Management zeigt sich: Mitarbeitende fürchten oft mehr, was sie verlieren könnten, als dass sie sich über mögliche Gewinne durch Veränderungen freuen. Wer Veränderungen kommuniziert, sollte deshalb nicht nur Vorteile betonen, sondern auch die Risiken des Nicht-Handelns klar machen – etwa den Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Studien zeigen, dass solche Formulierungen die Bereitschaft zur Veränderung deutlich erhöhen können.
Mitmachen lassen und Spaß haben: Vom „IKEA-Effekt“ bis Nudging
Menschen schätzen Dinge, an denen sie selbst mitgewirkt haben, deutlich höher ein. Experimente und Praxisbeispiele – etwa aus der Finanzbranche – zeigen, dass selbst kleine Spielräume für eigene Beiträge die Akzeptanz von Veränderungen enorm steigern. Wer Mitarbeitende aktiv beteiligt, sorgt für mehr Identifikation und geringere Widerstände.
Nudging wiederum sind kleine Anstöße mit großer Wirkung. Mitarbeitende oder Bürgerinnen werden durch kleine, gezielte Impulse zu gewünschtem Verhalten bewegt, ohne sie zu bevormunden. Spielerische Anreize wie der musikalische Mülleimer am Flughafen in Kopenhagen, der beim Einwerfen von Abfall Melodien erzeugt, fördern nachhaltige Verhaltensänderungen. Auch der Hinweis auf soziale Normen – „Die Mehrheit nutzt schon das neue System“ – kann die Bereitschaft zur Veränderung erhöhen.
Praxistest im Frühstücks-Salon im Mai 2025
Bei unserem 18. Frühstücks-Salon des „Team Salon Breite Gasse“ am 28.5.2025 beleuchteten wir die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie mit Change Verantwortlichen aus dem Gesundheits- und Universitätsbereich, mit Arbeitsmarkt-Verantwortlichen und Wirtschaftstreibenden. Ihre Erfahrungen aus der Praxis zusammengefasst:
• Das Werkzeug „Partizipation“ ermöglicht Gestaltungsspielräume, aber muss wirklich immer bis zu Ende gedacht werden. Wieviel und welche Form der Mitarbeiter*innen-Partizipation verträgt die Organisation und das mittlere Management?
• Nudging ist als Konzept bekannt, aber noch nicht gezielt eingesetzt. Hier braucht es noch Experimentier-Räume und gute Ideen, um neue Verhaltensweisen zu fördern.
• Risiken und Verluste des Status quo klar kommunizieren: nicht Angst machen, sondern ein klares Problembewusstsein schaffen. Das setzt aber konsequente Kommunikation top-down mit echten Zahlen voraus, die in der volatilen Wirtschaftslage derzeit schwanken.
• Mehr emotionale Dynamiken im Team berücksichtigen und Raum für Gefühle lassen. Führungskräfte brauchen Schulung in Bezug auf das Emotionen-Management.
Bildquelle: ChatGPT erstellt am 4.06.2025