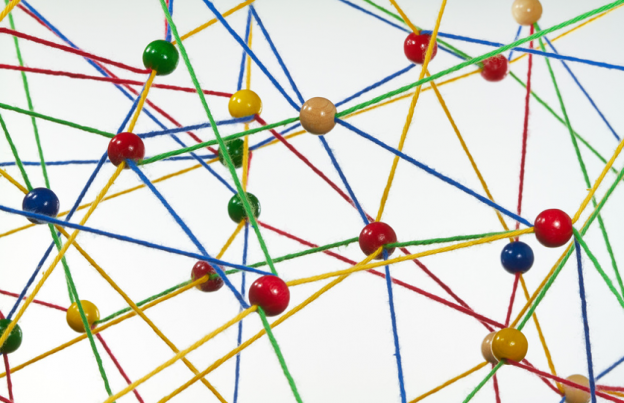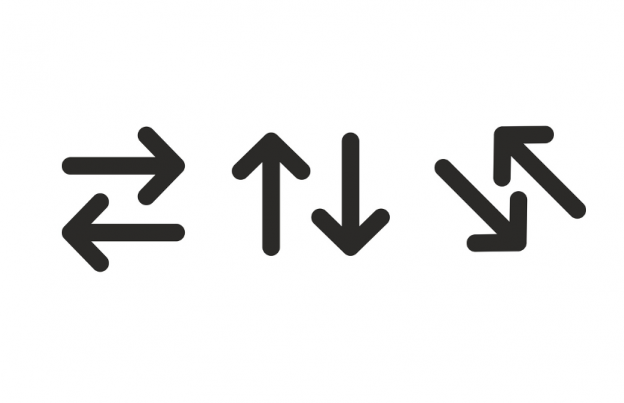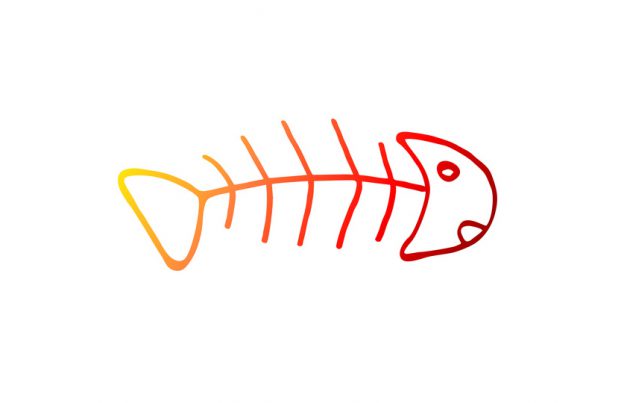Zwei Mal im Jahr fand bei uns am Land früher die Sperrmüll-Aktion statt – einmal mitten im Sommer. Große, ungenutzte oder abgenutzte Gegenstände konnten vor die Tür gestellt werden und wurden binnen drei Tage abgeholt. Weg waren sie. In der Großstadt gibt es das nicht. Wer eine alte Matratze oder eine Kredenz der Großmutter loswerden will, muss selbst zur Sammelstelle fahren. Damit wird das Loslassen von Altem schwerer.
Eine Sperrmüll-Aktion wie damals, das täte vielen Organisationen heute gut. Ein bis zwei Mal im Jahr alte Stapel von Papier, die niemand liest, wirklich weg zu werfen, statt zu verstauen.
Prozesse und Abläufe auf ihr Sinnhaftigkeit zu prüfen und bevor sich unnotwendige Schleifen manifestieren, diese zu lösen. Wichtig dabei ist ein bewusster Akt: Entsorgen Sie überkommenen Dinge auch wirklich sichtbar!
Ein CEO, mit dem wir viel und gerne arbeiten, trommelt zwei Mal im Jahr seine Belegschaft zusammen. Dann wird alles ausgemistet, was nicht mehr gebraucht und nicht mehr sinnvoll ist und vor den Augen aller zerrissen oder weggeschafft.